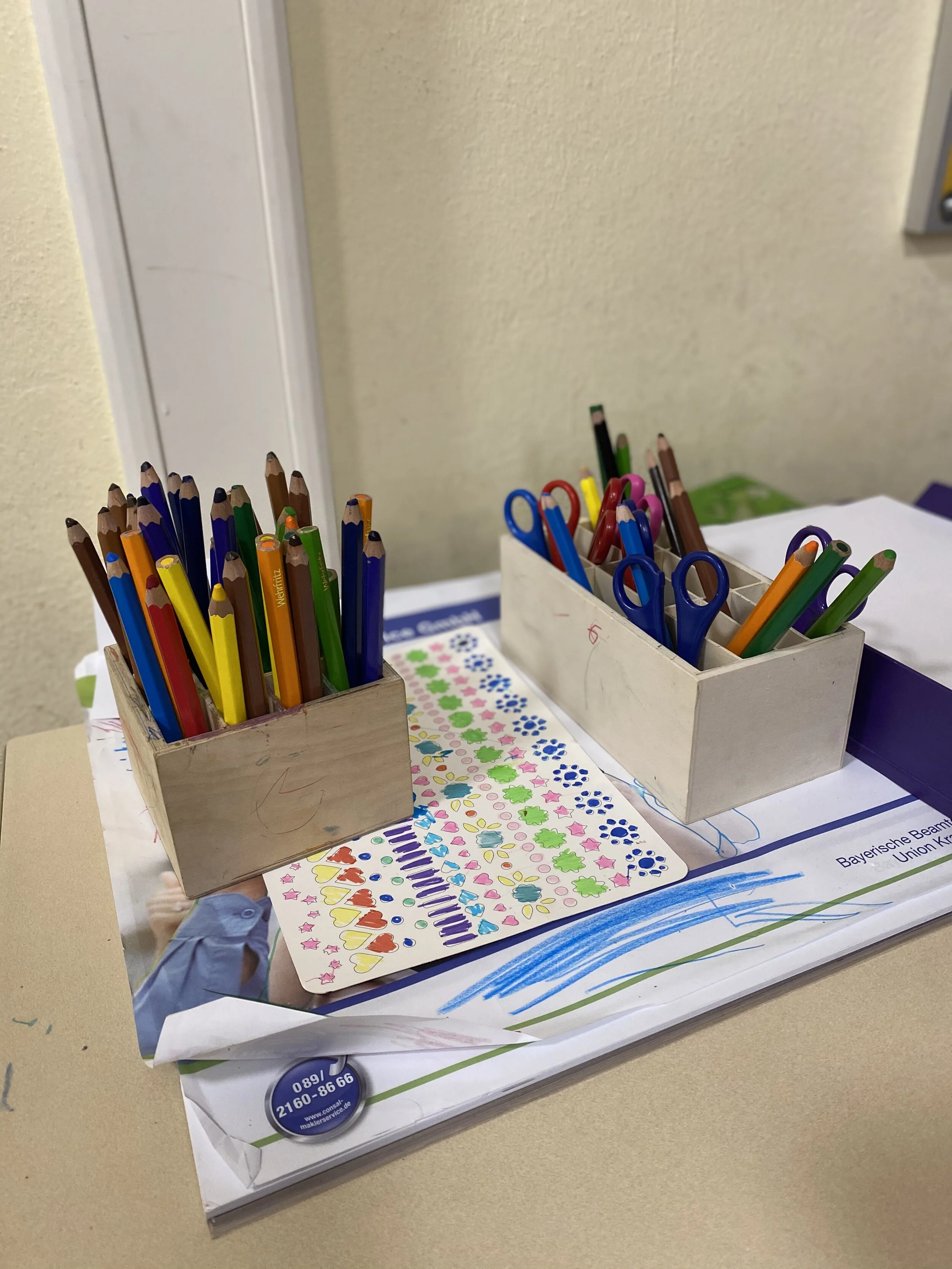Funktionaler Analphabetismus
Millionen Deutsche können nicht ausreichend lesen und schreiben
Die Betroffenen sind täglich mit vielen Problemen und Hürden konfrontiert. Dennoch ist funktionaler Analphabetismus immer noch ein Tabuthema.
Analphabetismus ist ein weltweites Problem: Mehr als 750 Millionen Erwachsene haben keine grundlegenden Lese- und Schreibkenntnisse.
In Deutschland sind 6,2 Millionen Menschen von funktionalem Analphabetismus betroffen: Sie können nicht ausreichend lesen und schreiben.
Funktionale Analphabeten in Deutschland
Analphabetismus im historischen Kontext
Noch vor 150 Jahren fielen Analphabeten kaum auf. So wie beispielsweise im Preußen des Jahres 1899. Damals waren die Anforderungen gering. Meist reichte es, wenn man den eigenen Namen auf der Heiratsurkunde schreiben konnte.
20 Jahre später, 1919, wurde die Weimarer Verfassung unterzeichnet. Fortan war die Schulpflicht für ganz Deutschland festgeschrieben 1). Dennoch gab es weiterhin sehr viele Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben konnten.
Bildungspolitische Fortschritte im 20. Jahrhundert
Mit der gesellschaftlichen Entwicklung stiegen die Bildungsanforderungen. Neue Technologien wurden eingeführt. Der Arbeitsmarkt wurde umstrukturiert.
In den 1970er Jahren gab es immer weniger Stellen für Hilfskräfte. Ab den 80er Jahren mussten auch Hilfsarbeiter das Lesen und Schreiben beherrschen. Wer es nicht konnte, rutschte in die Arbeitslosigkeit.
Der Ruf nach Lösungsmöglichkeiten wurde lauter. Er wurde zaghaft umgesetzt: Im Jahr 1976 bot die Volkshochschule in Bremen den ersten Lese- und Schreibkurs für Erwachsene an.
1978 prägte die UNESCO den Begriff des funktionalen Analphabetismus:
„Ein funktionaler Analphabet ist jemand, der unfähig ist, alle Aktivitäten auszuüben, bei denen Lesen, Schreiben und Rechnen im Interesse eines guten Funktionierens seiner Gruppe und seiner Gesellschaft notwendig sind, und die ihn auch in die Lage versetzen, weiter diese Kulturtechniken in Hinblick auf seine eigene Entwicklung und die seiner Gemeinschaft zu nutzen.“ 2)
Heute wird funktionaler Analphabetismus als Untergruppe von Analphabetismus definiert:
1. Primärer Analphabetismus – Menschen, die nie lesen und schreiben gelernt haben (in Deutschland äußerst selten)
2. Sekundärer Analphabetismus – Die in der Schulzeit erlernten Kenntnisse gingen wieder verloren.
3. Semi-Analphabetismus - Menschen, die zwar lesen, aber nicht schreiben können (in Deutschland äußerst selten).
4. Funktionaler Analphabetismus – Menschen, meist in Industrieländern, die in der Schule zu wenige Kenntnisse und Fähigkeiten im Lesen und Schreiben erworben haben 3).
Funktionaler Analphabetismus in Deutschland heute
Welche Menschen sind am häufigsten betroffen?
2018 veröffentlichte die Universität Hamburg die LEO Studie 4): Jeder siebte deutsche Erwachsene im Alter von 18 bis 64 ist von funktionalem Analphabetismus betroffen:
- 4,2 Millionen Erwachsene können nur einzelne Sätze lesen und schreiben.
- 1,7 Millionen Menschen können nur einzelne Wörter lesen und schreiben.
- 300.000 Deutsche können keine Wörter lesen oder schreiben.
Von den insgesamt 6,2 Millionen Menschen
sind 3,3 Millionen in Deutsch sprechenden, familiären Umfeldern aufgewachsen.
haben 2,9 Millionen zunächst eine andere Sprache gelernt. In dieser Erstsprache haben sie viel bessere Lese- und Schreibkompetenzen.
Frauen sind zu 41,7% betroffen, Männer zu 58,4%. Geflüchtete und Zugewanderte sind ausgenommen 5). Vgl. Sprachförderung bei Kindern
Besonders betroffen sind
Menschen, deren Eltern einen geringen Bildungsstand haben.
Menschen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen.
Migrantenkinder: Sie können am schlechtesten lesen, rechnen und mit dem Computer umgehen 6).
In Deutschland hat Bildung und Ausbildung einen hohen Stellenwert. Die zunehmende Digitalisierung verstärkt das Problem: Sie sind Außenseiter.
Welche Ursachen hat funktionaler Analphabetismus?
Viele Faktoren kommen zusammen
Analphabetismus ist keine Krankheit. Neurobiologische Faktoren spielen aber eine Rolle: Bei funktionalen Analphabeten sind Nervenzellen, die für die Hörwahrnehmung zuständig sind, schlechter ausgebildet als bei Erwachsenen mit normalen Lesefähigkeiten. Besonders die Übersetzung von Lauten in Schriftzeichen ist gestört 7).
Dennoch sind viele andere Faktoren mitverantwortlich: Es ist ein „Zusammenspiel von gesellschaftlichen, familiären, schulischen und individuellen Faktoren“:
Dazu zählen hohe Fehlzeiten in der Schule. Negative Erfahrungen im Elternhaus und in der Schule können prägend sein. Auch emotionale Vernachlässigung oder andere psychische Belastungssituationen können beeinflussend wirken.
Sozialkulturelle Ursachen
Viele Betroffene haben Eltern ohne einen Schulabschluss.
Sie hatten als Kind zu Hause wenig Hilfe bei schulischen Problemen. Die Eltern waren überfordert und desinteressiert. Ihre Schulzeit empfanden sie als quälend.
Die Eltern hatten selbst kein Interesse am Lesen und Schreiben. Das überträgt sich auf die Kinder – auch bei Kindern aus „intakten“ Familien.
Die Kinder wurden in der Schule überfordert. Ihre Defizite wurden nicht erkannt und nicht ausgeglichen.
Viele sind in sozial schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Sie haben Gewalt erlebt, finanzielle Probleme, familiäre Ablehnung.
Wichtig ist die Abgrenzung zur Legasthenie: Hier liegen neuronale Störungen vor. Betroffenen Personen haben Schwierigkeiten, Buchstaben und Zeichen zu Wörtern zusammenzufügen 8).
Wie leben funktionale Analphabeten?
Ein Alltag in ständiger Angst
Für funktionale Analphabeten ist jeder Tag ein wahrer Spießrutenlauf. Sie befürchten, dass ihr Defizit von Vorgesetzten oder im sozialen Umfeld erkannt wird.
Sie wissen, sie lesen unsicher. Teilweise müssen sie einen Lesefinger benutzen, um sich im Text zurechtzufinden. Sie können zwar einzelne Wörter oder Sätze lesen und schreiben – allerdings auf dem Niveau eines Grundschülers in der zweiten oder dritten Klasse.
Sie können den Sinn eines längeren Textes nicht verstehen. Wörter schreiben sie oft so, wie sie sie hören. Sie schreiben mit krakeliger oder unsicherer Schrift. Viele entwickeln sogar eine eigene Schrift.
Jeden Tag müssen sie Situationen vermeiden, in denen sie sich unsicher fühlen. Sie entwickeln immer mehr Vermeidungsstrategien.
Was für andere selbstverständlich ist, ist für funktionale Analphabeten eine tägliche, schier unüberwindbare Herausforderung.
Im Berufsleben
Sie haben ständig Angst, am Arbeitsplatz negativ aufzufallen. Oft weiß der Arbeitgeber nichts.
Jobwechsel sind schwer: Das Lesen von Stellenanzeigen und Erstellen eines aussagekräftigen Lebenslaufs sind kaum lösbare Aufgaben.
Sie wissen, sie haben auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen.
Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist stark erhöht. Unter den Arbeitslosen befinden sich mehr als 30% funktionale Analphabeten. Das sind doppelt so viele wie in der Gesamtbevölkerung.
Arbeiten am Computer ist ihnen nahezu unmöglich. In einer immer stärker digitalisierten Welt ist es aber unerlässlich. Auch in Einfacharbeitsplätzen werden PC-Kenntnisse zunehmend erwartet.
Sobald sich der Verantwortungsbereich eines Beschäftigten erweitert, steigen auch die schriftsprachlichen Anforderungen. Das gilt auch im Helferbereich.
Im normalen Alltag müssen Hilfskräfte höchstens unterschreiben, z.B. auf Lieferscheinen. Eine Zusatzaufgabe wäre das orthographisch korrekte Verfassen von Briefen, eventuell am Computer. Auch das ist kaum möglich.
Sie können wichtige Warnhinweise am Arbeitsplatz nicht lesen.
Im Privatleben
Viele schämen sich vor Freunden oder sogar ihrem Partner.
Oft verheimlichen sie es sogar vor ihren Kindern.
Sie brauchen Hilfe zum Lesen von Rechnungen, Verträgen, Bedienungsanleitungen, etc.
Fahrpläne, Ticketkauf am Bahnhof, stellen ein unüberwindbares Hindernis dar.
Sie nehmen offizielle und behördliche Formulare heim, anstatt sie vor Ort schnell auszufüllen.
Viele geraten in die Schuldenfalle oder bekommen Ärger mit den Ämtern. Sie haben Angst, nicht zu verstehen, was der Inhalt des Amtsschreibens bedeutet. Deshalb legen sie einen offiziellen Brief, eine Mahnung, lieber weg 9).
Viele Betroffene befürchten, von ihrer Umwelt als „dumm“ abgestempelt zu werden. Sie haben Angst vor dem soziales Stigma und vor Ablehnung. Viele ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben immer weiter zurück.
Viele leiden unter psychischen Problemen
Das ständige Versteckspiel zehrt an den Nerven und raubt Energie. Eine Abwärtsspirale mit unvorstellbarem Leidensdruck entsteht. Die ständige Angst, „aufzufliegen“, hinterlässt Spuren. Viele Betroffene versuchen, sich mit Notlügen zu retten. „Ich habe die Brille vergessen“ ist eine häufig verwendete Ausrede.
Manche fügen sich ernste Selbstverletzungen zu. Sie brechen sich beispielsweise die Finger, um nicht schreiben zu müssen. Andere verbrennen sich absichtlich die Hände.
Nicht wenige funktionale Analphabeten geraten im Laufe der Jahre in eine tiefe Lebenskrise, die sie nicht mehr bewältigen können 10).
Vgl. auch: Kind hat keine Freunde im Kindergarten – Ursachen & Tipps
Der Weg hinaus ist nicht leicht
Man darf den funktionalen Analphabetismus nicht als selbstverschuldete Unfähigkeit betrachten. Obwohl es Maßnahmen zum Lesen- und Schreiben lernen gibt, besteht das Problem weiterhin. Die Ursache liegt woanders:
Eine wichtige Rolle spielt die tief verwurzelte Selbstunsicherheit der Betroffenen:
Sie kommen beruflich nicht voran.
Sie trauen sich nichts zu.
Sie sind ständig innerlich angespannt.
Sie leiden unter psychischen Problemen und sozialer Isolation.
Viele sind depressiv, haben Beziehungsprobleme.
Sie suchen die Schuld bei sich und schämen sich.
Deshalb fällt es vielen funktionalen Analphabeten schwer, etwas zu unternehmen. Sie scheuen davor zurück, das Problem aktiv anzugehen 11). Das ist nicht verwunderlich.
Es braucht eine gehörige Portion Mut, um sich dazu durchzuringen, das Lesen und Schreiben als Erwachsener doch noch richtig zu lernen.
Viele befürchten, dass sie es nicht schaffen, einen Kurs durchzuhalten. Sie haben Angst, sich in der Öffentlichkeit und in oft fortgeschrittenem Alter nochmals an die Schulbank zu setzen 12).
Hinzu kommt: Viele können sich Lese- und Schreibkurse gar nicht leisten. Wer nur wenig lesen und schreiben kann, befindet sich nahezu immer auf der niedrigsten Einkommensstufe.
Sie sind weder dumm noch faul
Nach langen Jahren des Versteckspiels sind viele Betroffene zermürbt. Die negativen Klischees und Vorurteile zehren an ihnen.
Fakt ist:
Sie sind nicht faul: Ca. 62 Prozent aller funktionalen Analphabeten arbeiten - meist als Hilfskräfte. Sie üben einfache Tätigkeiten und (schwere) körperliche Arbeit aus.
Sie sind nicht dumm: Es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen funktionalem Analphabetismus und Intelligenz.
Vgl. auch Mein Kind will sich nicht anstrengen – Das steckt dahinter!
Die Folgen der Digitalisierung
Seit Corona spielt die Digitalisierung eine noch größere Rolle. Ein sicherer Umgang mit dem PC und digitalen Lernmedien wird immer wichtiger für Erwachsene - und für Kinder.
Während der Pandemie zeigte sich: Sozial schwache Kinder haben oft zuhause keinen Zugang zu einem PC oder Drucker. Sie können nicht am digitalen Unterricht teilnehmen. Sie haben keinen Zugang zu Internet und digitalen Unterrichtsmedien.
In den langen Monaten des Homeschoolings haben sie nicht lesen und schreiben geübt. Sie konnten mit ihren Klassenkameraden nicht mithalten. Die entstandenen Defizite sind schon jetzt kaum mehr reversibel und ausmerzbar.
Ausblick:
Jedes deutsche Kind unterliegt einer neunjährigen Schulpflicht. Ein großer Teil der Kinder erreicht auch das jährliche Klassenziel.
Einige Kinder aber brechen die Schule ab.
Viele von ihnen werden nie eine Ausbildung machen.
Weil die Eltern sich nicht gekümmert haben. Weil sie eine schwere und traumatische Kindheit hatten. Weil die Eltern sich die Ausbildungszeit nicht leisten konnten oder wollten.
Funktionale Analphabeten der nächsten Generationen werden zunehmend Unsicherheit erfahren. Die Folgen von COVID-19 in diesem Zusammenhang werden sich erst in vielen Jahren zeigen. Die Situation wird sich weiter verschärfen.
Später im Leben werden sie kaum überwindbare Hürden und Stigmatisierung erfahren. Als Kinder können sie die Folgen noch nicht erahnen.
Vgl. 5 Entwicklungsbereiche von Kindern (Überblick)
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Wir bemühen uns, Ihnen hochwertige und informative Beiträge zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie uns ein kleines Danke sagen wollen, dann unterstützen Sie gerne unsere Kinderhilfsprojekte der Deutschen Lebensbrücke mit einer kleinen Spende. Jeder Euro zählt. Herzlichen Dank!
Quellen:
1) Wikipedia - Schulpflicht
2) Grin - Hey, Daniel: Funktionaler Analphabetismus
3) Peter Hubertus - Alphabetisierung
4) LEO 2018
5) Die Zeit: Buchstäblich ganz unten
6) Dominique Dauser: Arbeitsmarktchancen arbeitsloser funktionaler Analphabeten verbessern
7) Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik: Funktionaler Analphabetismus
8) iCHANCE.de
9) Dominique Dauser: Arbeitsmarktchancen arbeitsloser funktionaler Analphabeten verbessern
10) Frankfurter Neue Presse: Wörter werden zu Feinden
11) gesundheit.de: Analphabetismus: Die Folgen
12) Steffen Kleint: Funktionaler Analphabetismus –Forschungsperspektiven und Diskurslinien