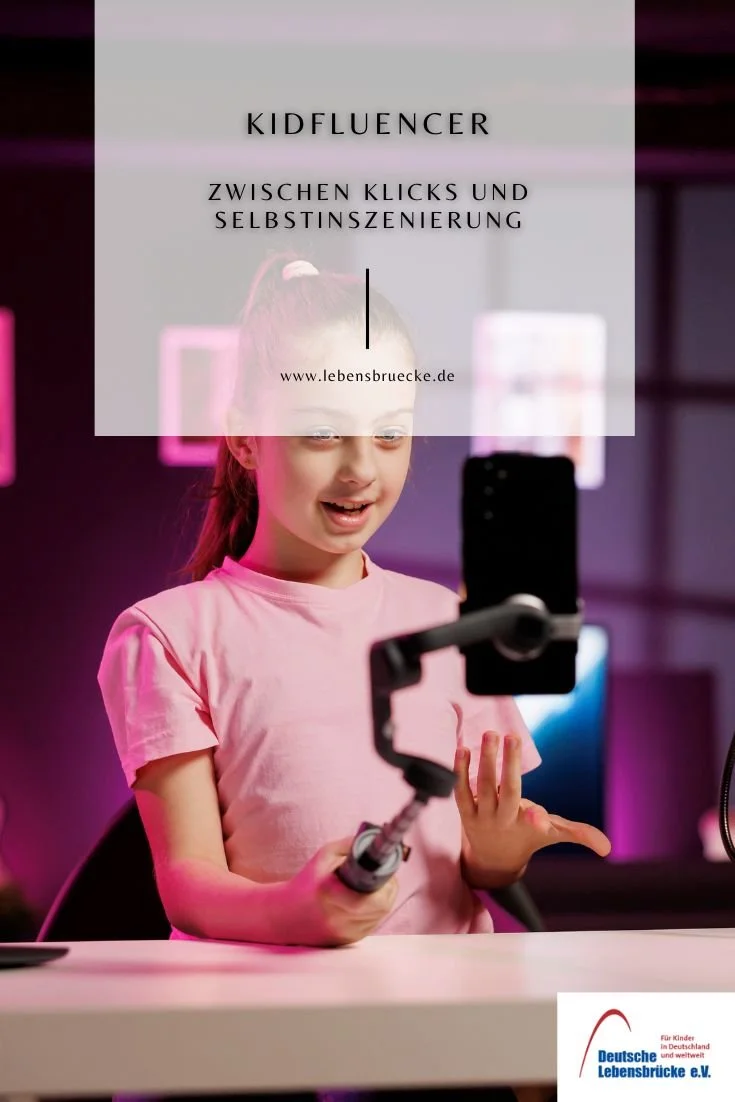Kidfluencer: zwischen Klicks & Selbstinszenierung
Immer mehr Kinder haben ihren eigenen Blog oder Vlog. Viele von ihnen sind schon von klein auf daran gewöhnt, sich im Netz zu sehen, weil ihre Eltern ihr Familienleben mit einer Community teilen. Was als Spaß beginnt, kann für Kidfluencer gefährliche Folgen haben. Wie überall: Das Maß macht’s.
Kinder als Influencer: Content oder Charakter?
Die Grenzen sind manchmal fließend
Celine (Name geändert) ist 10 Jahre alt und hat einen eigenen WhatsApp-Kanal
Täglich postet sie Bilder aus ihrem „Beautiful Life“, so heißt ihr Channel. Sie zeigt ihre Katze, ihr Zimmer, Fotos und Videos von Unternehmungen, von Zoo bis Kinderdisco. Sie gibt Styling-Tipps und promotet Nagellack und Lippenstift. Celine hat 1000 Abonnenten. Das ist zwar noch nicht wirklich viel, aber ihre Vorbilder Mavie, Lisa und Lena, Zoamee und Hi.lillea, haben auch mal klein angefangen.
Woher kommt der Trend zur Gleichschaltung?
Kidfluencer wie Celine kümmern sich in ihren Posts nicht um Rechtschreibung. Ebensowenig wie ihre Follower. Sie schreiben auch nichts wirklich Neues oder Originelles. Aber die Freundinnen lieben es. Sie haben die gleichen Vorbilder. Influencerinnen, kaum dem Teenageralter entwachsen, aber schon mit einer Riesengefolgschaft und lukrativen Accounts auf TikTok, Youtube, Instagram & Co.
Woher kommt dieser Trend zur Gleichschaltung? Ist er gefährlich oder inspiriert er die jungen, meist weiblichen Abonnenten?
Influencer*innen sind nichts Neues. Es gab sie schon vor den sozialen Medien und sogar weit vor Disney TV, Justin Timberlake, Hannah Montana und Taylor Swift.
Bevor Likes, Follower und Algorithmen
den Ruhm bestimmten, hießen Influencer schlicht Vorbilder – Menschen, deren Stil, Haltung oder Lächeln ganze Generationen prägten.
Von Shirley Temple zu TikTok
Wie aus Vorbildern Influencer wurden
1930er Jahre – Shirley Temple war das erste global vermarktete Kinderidol. Mit Lockenkopf, Grübchen und Liedchen wurde Temple zur Projektionsfläche für kindliche Unschuld – und gleichzeitig zum ersten Beispiel dafür, wie Filmstudios ein Kinderimage gezielt verkauften. Ihr Einfluss auf Mode, Frisuren und Verhalten anderer Kinder war enorm – ganz ohne Social Media.
1950er bis 60er Jahre
Lilo Pulver verkörperte in Deutschland und der Schweiz Lilo Pulver das Nachkriegsideal: heiter, sauber, charmant, unpolitisch. Sie stand für eine ästhetisch und moralisch codierte Weiblichkeit, deren Wirkung – ähnlich wie heute bei Influencerinnen – auf Nähe und Sympathie beruhte, nicht auf Distanz und Glamour. Pulver war im Prinzip ein „analoges Role Model“, das durch Zeitschriften, Kino und Werbung verbreitet wurde.
1980er Jahre
MTV kreierte die visuelle Dauerverfügbarkeit von Stars: Madonna, Michael Jackson oder Nena bestimmten plötzlich Mode, Sprache und Gesten – der Einfluss wanderte von der Leinwand zum Bildschirm. Der Begriff „Vorbild“ blieb, aber die Mechanik wurde kommerzieller, reproduzierbarer. Stars begannen, Produkte und Lebensstile direkt zu „verkaufen“.
2000er Jahre
Mit Disneys „Hannah Montana“ verschmolzen zum ersten Mal das private und das öffentliche Ich zur Marke mit Doppelidentität. Miley Cyrus spielte ein Mädchen, das in der Schule unauffällig ist und auf der Bühne Superstar – eine frühe Blaupause für das, was Social Media später perfektionierte: Selbstvermarktung als Identität.
2010er Jahre bis heute
Taylor Swift führt dieses Prinzip zur Vollendung: Authentizität als kalkulierte Erzählung. Sie nutzt Nähe, Verletzlichkeit und strategisches Storytelling, um Kontrolle über ihr Image zu behalten – ein Balanceakt zwischen Nahbarkeit und Markenmanagement. In dieser Phase wurden Influencer zu eigenständigen Akteuren, die keine Studios oder Labels mehr brauchten: nur ein Smartphone, eine Kamera und eine Geschichte.
Heute
Influencer sind die demokratisierten Erben der Stars – jeder kann einer werden. Der Unterschied: Während Shirley Temple von Studios gesteuert wurde, steuern heutige „Selfmade-Influencer“ sich selbst – oder glauben es zumindest.
Zwischen Klicks und Selbstinszenierung:
Wenn Kinder lernen, dass Sichtbarkeit wichtiger ist als Sein
Zunächst einmal ist es ja nicht schlimm oder sogar gut, wenn Jugendliche in den sozialen Medien Anerkennung finden. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein und schärft außerdem Softskills (soziale Kompetenzen), die heute wichtig sind. Aber ab wann droht die Balance zu kippen? Wann wird aus dem Zeitvertreib eine Sucht – und was macht das mit der Psyche und dem realen Leben der Kidfluencer?
Die Balance kippt, wenn soziale Medien nicht mehr ergänzend, sondern zentral für das Selbstwertgefühl werden. Denn dann wird aus einem Freizeitspaß gefährliche Abhängigkeit.
Wo Anerkennung nicht mehr guttut, sondern gebraucht wird, um sich sicher zu fühlen, wenn Likes und Follower zur wichtigsten Währung des Selbstwertes werden, verdrängen sie Schlaf, Freundschaften und echte Erfahrungen. Kidfluencer geraten dann in eine Dauerrolle, in der sie nicht mehr nur zeigen, wer sie sind, sondern wer sie sein sollen.
Das Ergebnis ist eine brüchige Identität, die von äußeren Rückmeldungen abhängt – und damit verletzlich wird.
Bei diesen typischen Anzeichen sollten Eltern aufpassen
Nutzung mehr als 3 Stunden täglich (JIM-Studien, DAK)
häufiges, impulsives Checken von Likes und Kommentaren
Unruhe oder Gereiztheit, wenn das Gerät weggelegt werden soll
Rückgang von Schlaf, Hobbys, Freundschaften oder schulischer Leistung
die Stimmung hängt spürbar davon ab, wie Posts ankommen.
Mehr erfahren » Selbstwahrnehmung bei Kindern
Was passiert psychologisch?
Social Media aktivieren das Belohnungssystem (Dopamin). Jede positive Rückmeldung wird zur Bestätigung, die immer öfter gesucht wird, um das Belohnungsgefühl zu erhalten.
Die Selbstwertregulation verschiebt sich: statt „Ich bin okay, wie ich bin“ → „Ich bin okay, wenn ich gut ankomme“. Das nennt man extern orientiertes Selbstwertmodell, und das ist extrem instabil. Das Kind wird dadurch sehr leicht verletzbar. (emotionaler Stress bei Kindern)
Kinder & Jugendliche haben noch kein stabiles Selbstbild
Die von ihnen gepostete Online-Rolle wirkt zurück auf ihre reale Identität. Es entsteht eine Dauerperformance:
„Wie wirke ich?“ wird wichtiger als „Was fühle ich?“
Das ist die Gefahr für Kidfluencer
Die Konsequenz sind Selbstzweifel, z. B. wenn das Engagement abnimmt oder die Likes und – noch schlimmer – die Followerzahlen sinken. Das wird vom Kindfluencer als persönliches Versagen verstanden.
Hinzu kommt der starke Vergleichsdruck durch andere Influencer. „Was macht die besser als ich?“ „Ich muss das unbedingt auch hinkriegen.“ Gleichzeitig fühlen sich die Kidfluencer vielleicht minderwertig, wenn sie mit den geposteten Inhalten ihrer „Konkurrenz“ nicht mithalten können.
Entweder aus materiellen bzw. finanziellen Gründen, vielleicht weil ihre Eltern sich gewisse Dinge einfach nicht leisten können, wie teure Urlaube (Urlaubsarmut) oder besondere Klamotten. Oder, weil sie sich aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Leistungen und Fähigkeiten benachteiligt fühlen.
Das kann einmal zu Vorwürfen gegenüber den Eltern führen, dann aber auch zur Schaffung einer parallelen Persönlichkeit à la Münchhausen.
Eine andere Auswirkung ist oft, dass die Kinder sich an Dinge wagen, für die sie eigentlich kein Interesse haben, von denen sie aber glauben, dass sie sie interessanter machen. Das kann der Hip-Hop-Kurs sein, Snowboarden, waghalsige Schwimmbadsprünge – oder eine Klau-Tour in der Kosmetikabteilung.
Eine weitere Gefahr ist der Verlust von Privatheit (auch gegenüber Schule und Peergroup). Dieser Verlust kann von den Kidfluencern oft gar nicht eingeschätzt werden bzw. sie bekommen ihn erst dann zu spüren, wenn sie dadurch zum Gegenstand von Spott oder Mobbing werden. Die andere, riesige Gefahr ist natürlich, dass alle ihre Informationen und Bilder in kriminelle Hände geraten. Mit Folgen, die unter Umständen erst Jahre später zum Tragen kommen.
Diese erhöhten Risiken können Kidfluencer treffen
Angststörungen
depressive Verstimmung (vgl. Depression bei Kindern)
Ess- und Körperbildstörungen
soziale Rückzugstendenzen
Risiken für Kidfluencer Im realen Leben
Begegnungen werden inszeniert statt erlebt
Freundschaften werden messbar (Follower, Likes), persönliche, echte Freundschaften verlieren an Gewicht.
Aus Freizeit wird Arbeit
Inhalte werden irgendwann produziert statt gespielt. Das erfordert nicht nur ein immer größeres Maß an „erwachsener“ Produktivität, sondern u.U. auch immer mehr Equipment.
Aus Selbstdarstellung wird Geschäft
Wenn die Kidfluencer anfangen, echtes Geld zu verdienen, wird aus der kindlichen Selbstdarstellung ein Geschäft. Eltern, Management oder schlicht Algorithmus erzeugen Druck: „Wir brauchen heute noch Content“, „Streng dich mal mehr an.“ Dieses Szenario ist leider nicht so selten, wie viele glauben.
Sharenting
Wenn Eltern ihr Familienleben inkl. ihrer Kinder mit allen teilen.
Mehr erfahren >> Was ist Sharenting?